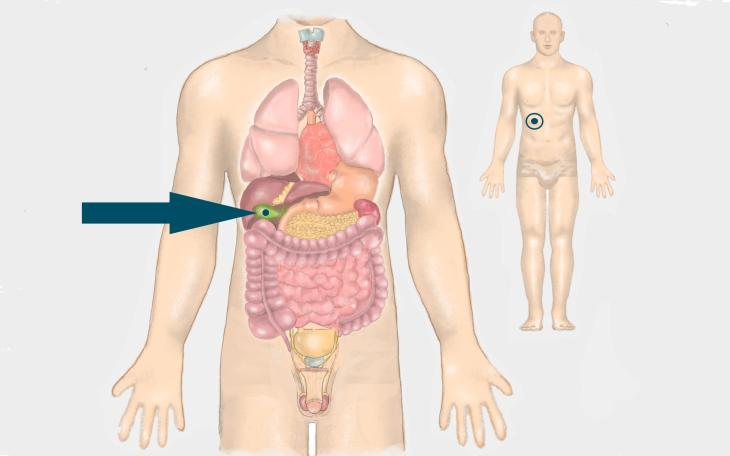Der Großteil der Gallenblasenentzündung tritt akut und plötzlich auf.
Leitsymptom sind heftige kolikartige Schmerzen, die dazu führen, dass Betroffene auch häufig mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden müssen.
Eine bakterielle Infektion kann, muss aber nicht vorliegen.
Ist ein Steinleiden die Ursache, kann eine Gallenblasenentzündung theoretisch auch von selbst wieder verschwinden, wenn der Stein spontan abgeht und somit der Stau wieder aufgelöst werden kann.
Im Großteil der Fälle wird jedoch entweder eine Notfall-Cholezystektomie (operative Gallenblasenentfernung) nötig oder die Operation wird elektiv (d.h. ausgewählt) innerhalb von 24 Stunden geplant.