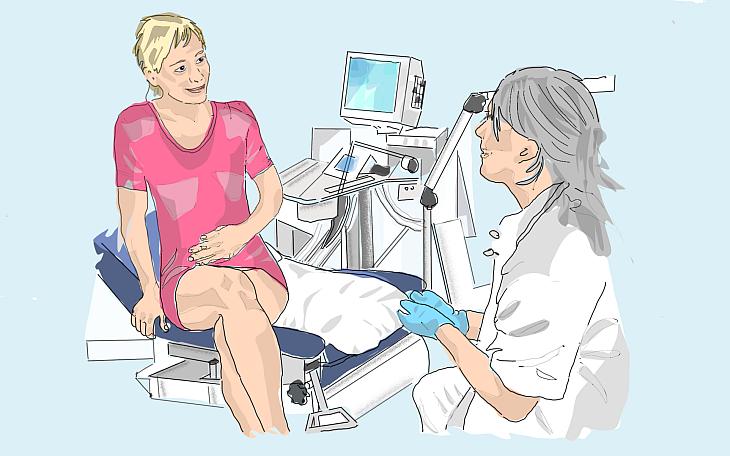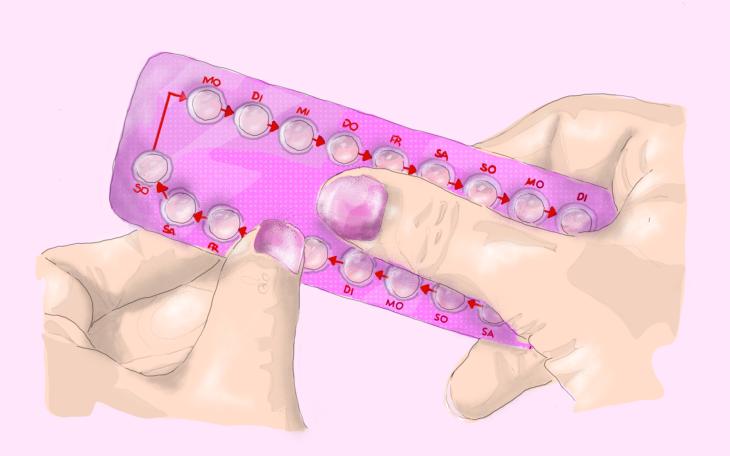Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist bei einem Polyzystischen Syndrom enorm wichtig.
Das hat mitunter auch damit zu tun, dass die richtige Ernährungsweise in Kombination mit körperlicher Betätigung zu einer deutlichen spürbaren Verbesserung der Beschwerden beitragen kann.
Betroffene Frauen sollten Nahrungsmittel, die stark verarbeitet sind oder einen sehr hohen Zuckeranteil haben, meiden beziehungsweise im besten Fall ganz weglassen.
Das hängt damit zusammen, dass ein hoher Zuckeranteil den Blutzucker schnell in die Höhe treibt und sich damit eher ungünstig auswirkt.
Eine gesunde Ernährungsweise umfasst in der Regel sehr viel Gemüse.
Als Faustregel gilt, ein Großteil des Platzes auf dem Teller sollte zu den Hauptmahlzeiten aus einer Portion Gemüse bestehen.
Weiterhin sollte auf die regelmäßige Aufnahme von pflanzlichem oder tierischem Eiweiß geachtet werden.
Bei Fleisch bestenfalls eher auf magere Sorten wie etwa Pute oder Hähnchenbrust setzen.
Zudem sollten gesunde Fette aus Ölen (zum Beispiel Olivenöl oder auch Nussöle) oder auch Nüssen (Cashewnüsse, Mandeln oder Walnüsse) ausgewählt werden.
Darüber hinaus gilt es auf die sogenannten „guten“ Kohlenhydrate zu setzen. Damit sind vor allem komplexe Kohlenhydrate gemeint, wie sie etwa in Vollkornprodukten vorkommen.
Diese lassen den Blutzuckerspiegel aufgrund ihrer chemischen Struktur viel langsamer, als sogenannte kurzkettige Zucker, wie sie in verarbeiteten Lebensmitteln häufig zu finden sind, ansteigen.
Natürlich darf auch Obst auf dem Speiseplan nicht fehlen, hier sollte aber aufgrund des beinhaltenden Fruchtzuckers auch auf die richtige Portionsgröße geachtet werden.
Weiterhin sollten vom PCO-Syndrom betroffene Frauen auch auf die regelmäßige Aufnahme von Omega 3 Fettsäure haltigen Speisen, wie Avocado, Leinsamen oder bestimmten Fischarten wie Lachs oder Forelle achten.