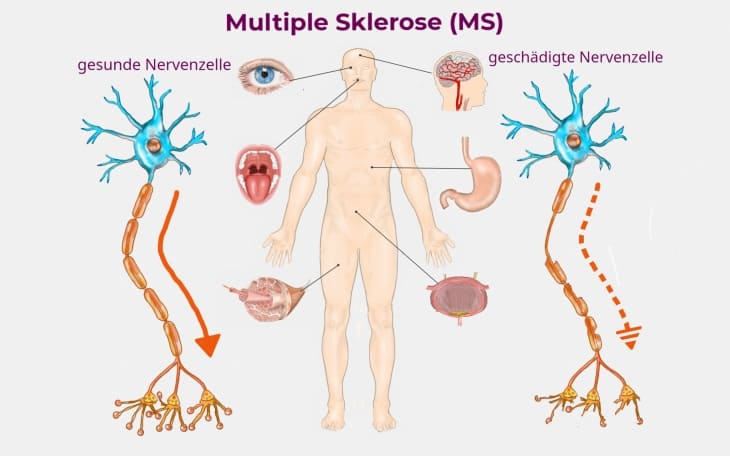Bei der Multiplen Sklerose werden verschiedene Verlaufsformen unterschieden.
Klinisch isolierte Syndrom
Das „KIS“ oder „klinisch isolierte Syndrom“ beschreibt im Grunde die erste klinische Manifestation einer möglichen MS, im Prinzip den ersten spürbaren Schub.
Schubförmig remittierenden MS
Bei 85 % - 90 % kommt es bei Krankheitsbeginn zur „Schubförmig remittierenden MS“ (RRMS).
Diese zeichnet sich durch einen Krankheitsbeginn zwischen dem 15. bis 29. Lebensjahr, gut abgrenzbaren Schüben mit vollständiger Remission (Erholung/Rückbildung) und keiner Krankheitsprogression in den Zwischenintervallen aus.
Schubförmig progrediente MS
Dazu im Gegensatz steht die „Schubförmig progrediente MS“, die von Beginn an eine progrediente Symptomatik aufweist, die Schübe aber ebenfalls eindeutig abgrenzbar sind und mit vollständiger Remission ablaufen.
Primär chronisch progredienten MS
Beim Krankheitsbeginn mit 39–41 Jahren, bei der sogenannten „Primär chronisch progredienten MS“ (PPMS), zeigt sich eine langsam progrediente Verschlechterung der Symptomatik ohne sichtbare oder abgrenzbare Schübe. Dabei sind Männer häufiger betroffen als Frauen.
Sekundär chronisch progrediente MS
Davon lässt sich die „Sekundär chronisch progrediente MS“ (SPMS) abgrenzen, die ihren Beginn im Alter zwischen dem 40. und 49. Lebensjahr nimmt.
Zu Beginn hat diese oft einen schubförmigen Charakter, im Verlauf aber eher einen progredienten ohne Schübe und Remission.
Akute Maligne MS
Die Akute Maligne MS (Typ Marburg) beschreibt eine seltene, aber hochmaligne (tödliche) Form der MS, bei der besonders junge Patienten betroffen sind.